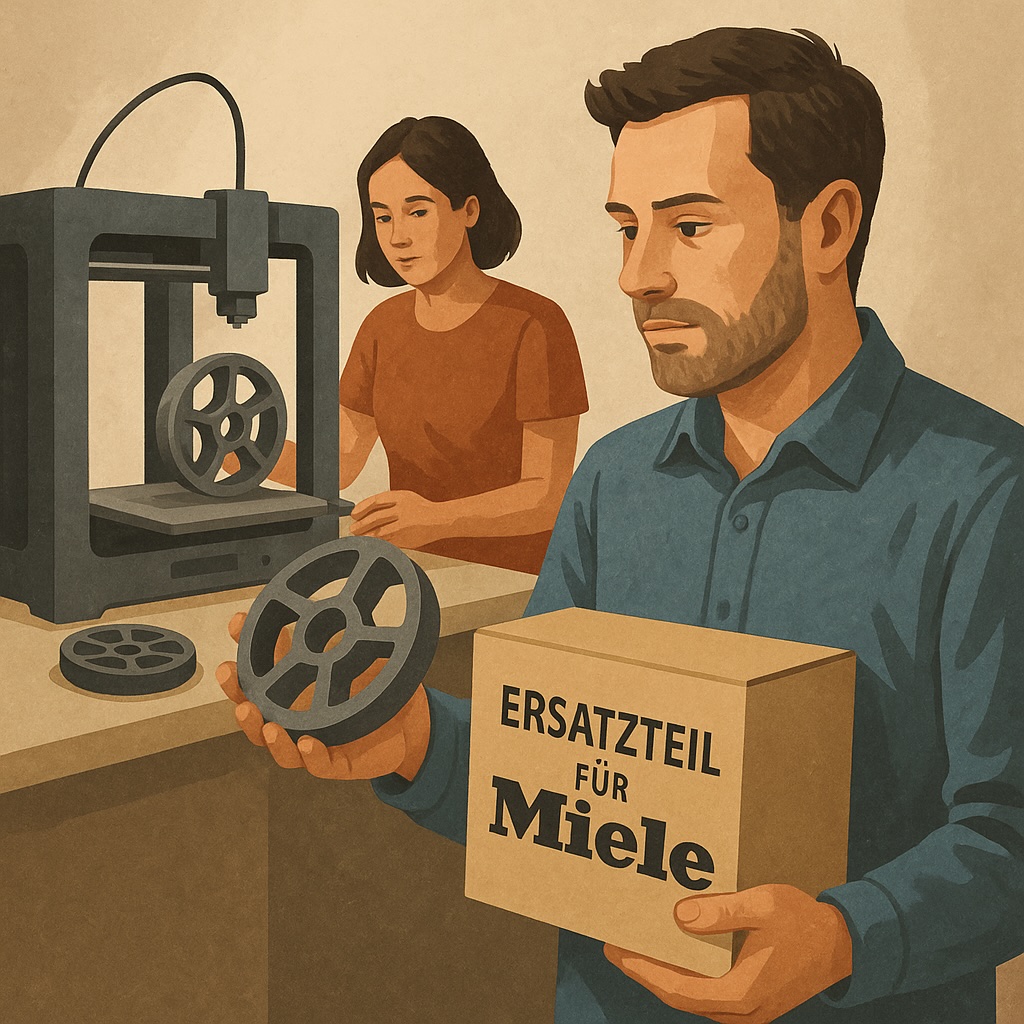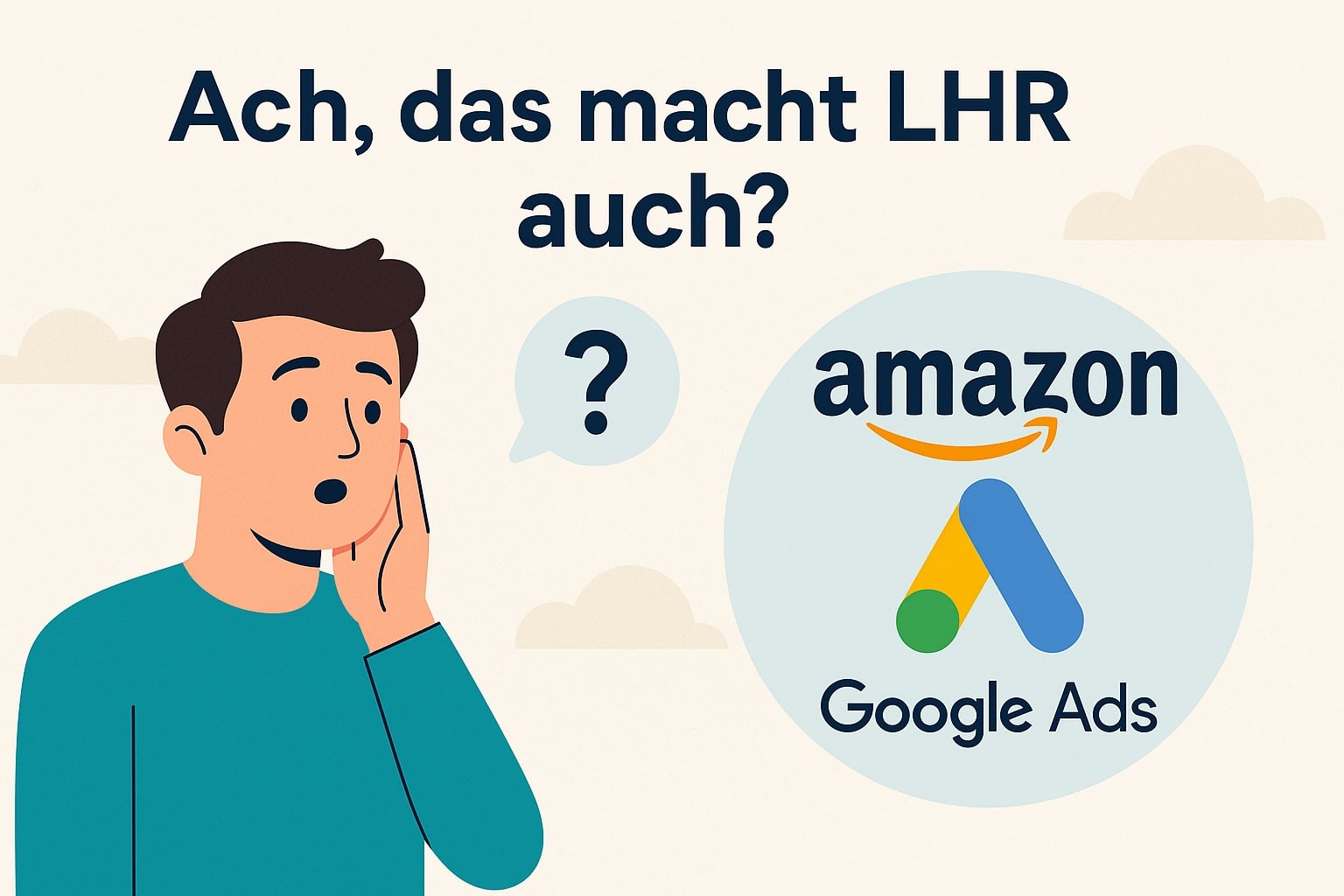LHR-Praxisfall: „Produktsicherheitsrichtlinie“ – Wenn Amazon seriösen Händlern das Leben schwer macht
 Eine neue Produktsicherheitsrichtlinie von Amazon sorgt derzeit bei vielen deutschen Händlern für blanke Nerven.
Eine neue Produktsicherheitsrichtlinie von Amazon sorgt derzeit bei vielen deutschen Händlern für blanke Nerven.
Während der Online-Riese mit verschärften Prüfpflichten scheinbar den Verbraucherschutz stärken will, droht für viele mittelständische Anbieter das wirtschaftliche Aus.
Was Amazon verlangt – und warum das problematisch ist
Seit Herbst 2025 verlangt Amazon von Händlern, die auf der Plattform Spielwaren verkaufen, für jedes einzelne Produkt einen sogenannten Testreport eines von Amazon akzeptierten Prüflabors. Ohne diesen Bericht wird das Produkt gesperrt. Das betrifft auch Artikel wie Badeenten oder Plüschtiere – Produkte, die seit Jahren beanstandungsfrei verkauft werden.
In der Praxis können viele Lieferanten diese Testberichte jedoch gar nicht beibringen. Manche Hersteller testen ihre Produkte intern oder mit Laboren, die nicht auf Amazons enger Liste der sogenannten TIC-Prüflabore stehen. Andere verweigern die Herausgabe der Berichte, weil darin sensible Informationen über chinesische Zulieferer enthalten sind. Das Ergebnis: Deutsche Händler stehen ohne verwertbare Nachweise da – und ihre Angebote werden von der Plattform entfernt.
Rechtliche Lage: Gesetzliche Pflicht oder Amazon-Bürokratie?
Tatsächlich existiert für Spielwarenhersteller und -händler keine gesetzliche Pflicht, jeden einzelnen Artikel von einem bestimmten akkreditierten Labor prüfen zu lassen. Entscheidend ist, dass das Produkt den europäischen Sicherheitsanforderungen genügt, insbesondere den Vorgaben der EU-Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG und des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG). Der Hersteller muss die Einhaltung dieser Anforderungen sicherstellen und dokumentieren – etwa durch eine Konformitätserklärung und die CE-Kennzeichnung. Wie er diese Sicherheit nachweist, bleibt ihm überlassen.
Amazon geht nun deutlich weiter und verlangt Dokumente, die über das gesetzlich Erforderliche hinausgehen. Rechtlich stützt sich die Plattform dabei auf ihre eigenen Marketplace-Richtlinien, also auf vertragliche Pflichten, die Händler mit dem Akzeptieren der Nutzungsbedingungen eingehen. Faktisch diktiert Amazon damit strengere Maßstäbe als der Gesetzgeber – mit gravierenden Folgen für tausende Händler.
Wer trägt eigentlich die Verantwortung?
Die Produkthaftung in der EU kennt das Konzept des sogenannten „Quasi-Herstellers“: Wer ein Produkt unter eigenem Namen oder Label verkauft oder in die EU einführt, gilt als Hersteller im Sinne des Produkthaftungsrechts (§ 4 Abs. 1 ProdSG, § 1 ProdHaftG). Damit trägt ein deutscher Händler ohnehin ein erhebliches Haftungsrisiko, selbst wenn die Ware ursprünglich aus China stammt. Für Verbraucher ist das ein Vorteil – sie haben stets einen europäischen Ansprechpartner.
Doch Amazons Vorgehen löst das eigentliche Problem nicht: Nach wie vor werden über die Plattform massenhaft Produkte unseriöser Anbieter vertrieben, die häufig außerhalb der EU sitzen, ihre Waren über Strohfimen oder Fulfillment-Strukturen einschleusen und für die niemand effektiv haftet.
Gerade diese Akteure werden durch Amazons neue Prüfanforderungen kaum erreicht. Stattdessen trifft es die seriösen deutschen Mittelständler, die sich längst an die hiesigen Standards halten und die gesetzlichen Pflichten ernst nehmen.
Der falsche Adressat der richtigen Idee
Niemand wird ernsthaft bestreiten, dass der Schutz von Kindern und Verbrauchern höchste Priorität haben muss. Aber die Art und Weise, wie Amazon seine „Produktsicherheit“ umsetzt, ist problematisch. Die Plattform schiebt die gesamte Verantwortung – und die Kosten – auf die Händler ab, die rechtlich ohnehin schon in der Pflicht stehen. Die geforderten Prüfberichte kosten pro Produkt zwischen 300 und 1.000 Euro. Bei mehreren tausend Artikeln ist das wirtschaftlich ruinös.
Hinzu kommt: Für Hersteller außerhalb Europas, insbesondere aus China, besteht nach wie vor kaum Kontrolle. Sie können teilweise ohne CE-Kennzeichnung oder Konformitätserklärung auf den Markt gelangen. Das eigentliche Ziel, die Sicherheit der Verbraucher zu erhöhen, wird damit verfehlt. Was bleibt, ist ein Bürokratiemonster, das die Falschen trifft – die ehrlichen Anbieter in Deutschland und Europa.
Verhältnismäßigkeit und mögliche rechtliche Ansatzpunkte
Aus juristischer Sicht könnte geprüft werden, ob Amazons neue Vorgaben verhältnismäßig sind und ob hier möglicherweise ein Missbrauch marktbeherrschender Stellung (§ 19 GWB) vorliegt. Als marktführende Plattform darf Amazon seine Position nicht dazu nutzen, unbillige oder sachlich nicht gerechtfertigte Anforderungen zu Lasten kleinerer Anbieter durchzusetzen.
Auch eine Ungleichbehandlung könnte in Betracht kommen, wenn sich zeigt, dass Amazon gegenüber Händlern außerhalb Europas andere Maßstäbe anlegt. Eine rechtliche Prüfung unter Gesichtspunkten des Wettbewerbsrechts und des AGB-Rechts kann hier sinnvoll sein – auch um zukünftige Fälle mit größerer Reichweite zu vermeiden.
Fazit: Gute Idee, schlechte Umsetzung
Die Idee, die Sicherheit von Spielwaren zu erhöhen, ist zweifellos richtig. Doch Amazons Umsetzung trifft die Falschen. Während unkontrollierte Billigimporte weiterhin durchrutschen, werden deutsche Mittelständler mit zusätzlichen Kosten, Formalien und existenziellen Risiken belastet. Wieder einmal droht derjenige zu verlieren, der ohnehin schon die gesetzlichen Pflichten erfüllt.
Es wäre an der Zeit, dass Plattformen wie Amazon ihre Verantwortung dort wahrnehmen, wo sie tatsächlich entsteht – bei der Kontrolle internationaler Lieferketten und der Bekämpfung unseriöser Anbieter – statt die eigenen Partner mit immer neuen Prüfpflichten zu überziehen.