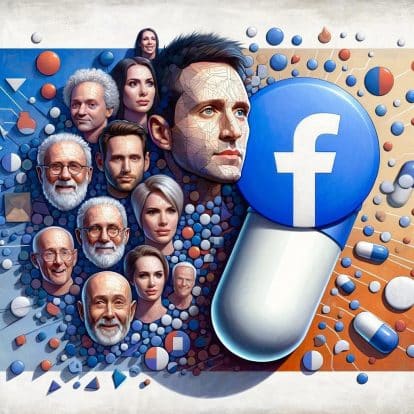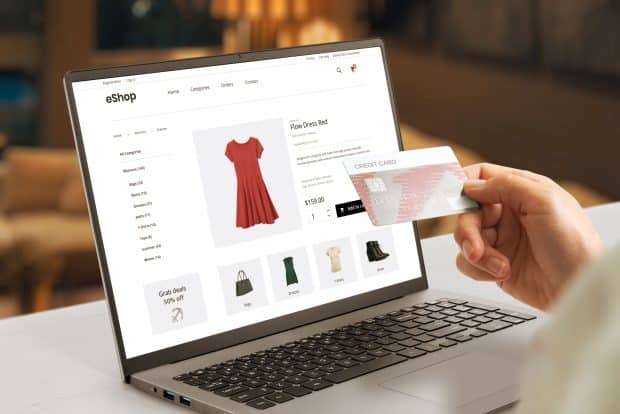Gericht untersagt irreführende Rabattwerbung mit durchgestrichenen Amazon-Preisen

Doch diese gängige Praxis der Rabattwerbung mit Streichpreisen hat nun ein gerichtliches Nachspiel: Das Landgericht (LG) München I erklärte am 14.07.2025 (Az. 4 HK O 13950/24) Amazons Preiswerbung in mehreren Fällen für rechtswidrig. Online-Händler auf Amazon – ob der Konzern selbst oder Marketplace-Verkäufer – riskieren demnach Abmahnungen wegen unlauterer Werbung, wenn sie weiterhin mit solchen durchgestrichenen Preisen und Prozentangaben werben.
Overview
- Hintergrund: Rabatte bezogen auf UVP statt auf eigenen Preis
- Amazon verteidigt die Werbung mit externen Vergleichspreisen
- Urteil: Verstoß gegen PAngV und Irreführung der Verbraucher
- Gericht lässt „UVP“-Hinweise und Mouse-over-Informationen nicht gelten
- Signalwirkung: Abmahnrisiken für alle Amazon-Händler
- FAQ: Rechtssichere Rabattwerbung auf Amazon
- Wann darf ich auf Amazon mit einem durchgestrichenen Preis werben?
- Kann ich weiterhin mit der UVP des Herstellers werben?
- Was sollte ich bei der Verwendung von „Statt-Preisen“ im Amazon-Backend beachten?
- Wie kann ich auf Preisaktionen (z. B. Black Friday) rechtssicher hinweisen?
- Ich kann den 30-Tage-Tiefstpreis auf Amazon nicht anzeigen lassen – was tun?
- Was passiert, wenn ich mich nicht an die Vorgaben halte?
- Gibt es aktuelle Entwicklungen zur Rechtslage?
- Fazit: Transparenz zahlt sich aus – rechtlich und wirtschaftlich
Hintergrund: Rabatte bezogen auf UVP statt auf eigenen Preis
Auslöser des Verfahrens war eine Aktion während der Prime Deal Days, bei der ein Händler (letztlich Amazon selbst) Preisermäßigungen bewarb, ohne den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage vor der Aktion anzugeben. Die angepriesenen „-19 %“ Rabatt und die Streichpreise bezogen sich stattdessen auf andere Referenzwerte – teils auf die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Herstellers, teils auf einen angeblichen „mittleren Verkaufspreis“ früherer Kunden auf Amazon.
Aus Sicht der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg führte diese Praxis die Kunden in die Irre: Ein Durchschnittsverbraucher gehe davon aus, dass ein durchgestrichener Preis oder ein Prozentsatz die Reduzierung gegenüber dem eigenen früheren Preis des Händlers anzeigt. Wüssten die Verbraucher, dass sich die Rabatte nur auf UVP oder Durchschnittspreise beziehen, würden sie die Preiswerbung weit weniger ernst nehmen. Die Verbraucherschützer sprachen sogar von einer „unzulässigen Lockwerbung“.
Amazon verteidigt die Werbung mit externen Vergleichspreisen
Amazon argumentierte, dass die neue Preisangabenverordnung (PAngV) in diesen Fällen gar nicht greife, da kein eigener früherer Preis gesenkt worden sei. Man habe transparent mit UVP oder Marktpreisen verglichen. Die durchgestrichene UVP sei klar als solche gekennzeichnet, und der angezeigte „Statt“-Preis (Durchschnitt der letzten 90 Tage) solle lediglich eine Orientierung bieten.
Aus Amazons Sicht handelte es sich somit nicht um eine klassische Rabattaktion, sondern um einen zulässigen externen Preisvergleich – ohne Pflicht zur Angabe des 30-Tage-Tiefstpreises.
Urteil: Verstoß gegen PAngV und Irreführung der Verbraucher
Das LG München I folgte der Sicht der Verbraucherzentrale vollumfänglich. Alle beanstandeten Werbemaßnahmen verstoßen laut Urteil gegen § 11 Abs. 1 PAngV und damit zugleich gegen das Wettbewerbsrecht (§ 5 UWG). Entscheidend sei die Erwartung eines durchschnittlich informierten Verbrauchers: Strichpreis-Werbung während Sonderaktionen wie Prime Deal Days werde unmissverständlich als Preissenkungswerbung verstanden – also als Hinweis auf einen zuvor höheren eigenen Preis.
Ein durchgestrichener Preis, kombiniert mit einem roten Hinweis wie „-19 %“, verstärke diesen Eindruck erheblich. In einem solchen Fall handelt es sich nach Auffassung des Gerichts nicht mehr um eine neutrale Gegenüberstellung zur UVP, sondern um eine echte Preissenkung – die zwingend den niedrigsten Gesamtpreis der letzten 30 Tage als Vergleichsmaßstab erfordert.
Gericht lässt „UVP“-Hinweise und Mouse-over-Informationen nicht gelten
Auch Amazons Praxis, ergänzende Infos per Mouse-over oder kleine UVP-Labels einzublenden, genügte dem Gericht nicht. Diese seien leicht zu übersehen oder würden missverstanden. Der Verbraucher nehme die Rabattinformation spontan auf – ohne den Hinweis korrekt einordnen zu können. Damit fehle eine wesentliche Information, was die Werbung unlauter mache.
Das Urteil zitiert den Europäischen Gerichtshof, der bestätigt hatte: Nur durch Nennung des 30-Tage-Tiefstpreises könne der Verbraucher objektiv über die Ermäßigung informiert werden.
Signalwirkung: Abmahnrisiken für alle Amazon-Händler
Die Entscheidung betrifft nicht nur Amazon selbst, sondern sämtliche Händler auf der Plattform, die mit ähnlichen Streichpreis-Rabatten werben. Zwar gestaltet Amazon die Preisdarstellung zentral, doch jeder einzelne Verkäufer haftet für unlautere Angaben in seinem Angebot.
Das bedeutet: Auch wenn das System durch Amazon vorgegeben wird, können Konkurrenten oder Verbände einzelne Marketplace-Händler abmahnen. Solche Verfahren sind zeit- und kostenintensiv – Händler sollten daher ihre Preiswerbung genau prüfen.
FAQ: Rechtssichere Rabattwerbung auf Amazon
Wann darf ich auf Amazon mit einem durchgestrichenen Preis werben?
Nur wenn der durchgestrichene Preis tatsächlich ein von Ihnen selbst verlangter Preis ist – und zwar der niedrigste Gesamtpreis, den Sie in den letzten 30 Tagen vor Beginn der Rabattaktion für das Produkt verlangt haben. Andernfalls handelt es sich um eine unzulässige Irreführung nach § 11 Abs. 1 PAngV i.V.m. § 5 UWG.
Kann ich weiterhin mit der UVP des Herstellers werben?
Ja, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen: Die UVP darf nicht wie ein Sonderpreis dargestellt werden. Vermeiden Sie Prozentangaben („-20 %“) oder auffällige Gestaltungen (z. B. rote Preise oder Schlagworte wie „nur heute“). Die UVP muss deutlich und verständlich als reiner Vergleichspreis erkennbar sein.
Was sollte ich bei der Verwendung von „Statt-Preisen“ im Amazon-Backend beachten?
Tragen Sie in das Feld für „Statt-Preis“ nur dann einen Wert ein, wenn dieser dem tatsächlichen 30-Tage-Tiefstpreis entspricht. Andernfalls besteht das Risiko, dass Amazon automatisch einen Streichpreis anzeigt, der rechtlich problematisch ist. Prüfen Sie regelmäßig, welche Preisangaben bei Ihrem Angebot öffentlich erscheinen.
Wie kann ich auf Preisaktionen (z. B. Black Friday) rechtssicher hinweisen?
Wenn Sie eine echte Preisreduktion anbieten, sollte der alte Preis mit Datum transparent angegeben werden. Beispiel: „Bisheriger Preis bis 01.10.2025: 99 €“ → Aktionspreis: 79 €“. So schaffen Sie Klarheit und vermeiden Irreführung.
Ich kann den 30-Tage-Tiefstpreis auf Amazon nicht anzeigen lassen – was tun?
Solange Amazon keine rechtskonforme Lösung anbietet, sollten Sie auf optisch auffällige Rabattdarstellungen verzichten. Alternativ können Sie im Beschreibungstext sachlich auf die Preisentwicklung eingehen oder vorübergehend keine Aktionspreise ausweisen, bis eine rechtssichere Darstellung technisch möglich ist.
Was passiert, wenn ich mich nicht an die Vorgaben halte?
Sie riskieren eine Abmahnung durch Wettbewerber oder Verbände wegen irreführender Werbung. Diese kann Unterlassungsansprüche, Vertragsstrafen und Rechtsverfolgungskosten nach sich ziehen. Auch Ordnungsgelder bei gerichtlichen Verstößen sind möglich – im Amazon-Fall drohten bis zu 250.000 €.
Gibt es aktuelle Entwicklungen zur Rechtslage?
Das Urteil des LG München I ist noch nicht rechtskräftig – Amazon hat Berufung eingelegt. Dennoch gilt bis zur Entscheidung durch höhere Instanzen die derzeitige Auslegung durch die Gerichte. Händler sollten sich daher auf die aktuelle Rechtslage einstellen und ihre Preiswerbung entsprechend anpassen.
Fazit: Transparenz zahlt sich aus – rechtlich und wirtschaftlich
Das Urteil aus München zeigt deutlich: Streichpreise und Rabattangaben müssen klar und korrekt sein. Wer Verbraucher mit vermeintlichen Nachlässen in die Irre führt, riskiert teure Abmahnungen – und verliert das Vertrauen seiner Kunden. Wer dagegen ehrlich kommuniziert, schützt nicht nur sich selbst, sondern stärkt auch seine Marke. Denn echte Rabatte überzeugen – Scheinrabatte schaden.