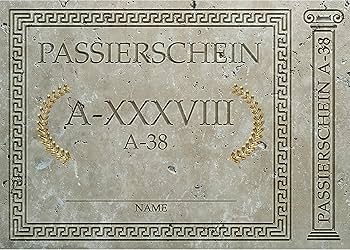Das Landgericht hatte die Antragstellerin im einstweiligen Verfügungsverfahren persönlich geladen und ein Ordnungsgeld verhängt, nachdem diese lediglich durch ihre anwaltlichen Vertreter – allerdings vollumfänglich informiert und bevollmächtigt – erschienen war.
Die Entscheidung des OLG Stuttgart ist nicht nur im konkreten Fall richtig, sondern auch grundsätzlicher Natur.
Sie ist ein notwendiger Hinweis an die Zivilgerichte, dass § 141 ZPO keine Grundlage dafür bietet, die mündliche Verhandlung in ein informelles Ermittlungsverfahren zu verwandeln und Parteien faktisch zu Verhörpersonen zu degradieren.
Der Sachverhalt: persönliche Ladung, informierte Anwälte, Ordnungsgeld
Das Landgericht Stuttgart hatte im Rahmen eines markenrechtlichen Verfügungsverfahrens das persönliche Erscheinen beider Parteien angeordnet. Die Antragstellerin, vertreten durch LHR Rechtsanwälte, entsandte zwei Anwälte, die in die Sache eingearbeitet und ausdrücklich bevollmächtigt waren, für ihre Mandantin zu verhandeln, zu vergleichen und Auskünfte zu erteilen.
Gleichwohl verhängte die Kammer ein Ordnungsgeld in Höhe von 300 Euro. Begründung: Die anwaltlichen Vertreter seien nicht „in der Lage gewesen, den Sachverhalt aufzuklären“ (§ 141 Abs. 3 S. 2 ZPO). Sie hätten einzelne Fragen zu einem behaupteten Treffen auf einer Fachmesse und zu Geschäftsbeziehungen zu einer dritten Person nicht beantworten können.
Colorandi causa: Ironischerweise erschien die Gegenseite durch eine Person, die sich als Geschäftsführer bezeichnete, tatsächlich aber gar keiner war – ein Umstand, der das Landgericht nicht weiter interessierte. Wir haben Strafanzeige erstattet, der Ausgang ist offen.
Der Beschluss des OLG Stuttgart: Ordnungsgeld war ermessensfehlerhaft
Das Oberlandesgericht Stuttgart hob den Beschluss auf und stellte klar, dass die Festsetzung des Ordnungsgelds “offenkundig” ermessensfehlerhaft war.
Nach ständiger Rechtsprechung – unter anderem des Bundesgerichtshofs (Beschl. v. 22. 06. 2011 – I ZB 77/10) – kommt eine Sanktion nach § 141 Abs. 3 ZPO nur dann in Betracht, wenn das Ausbleiben einer Partei die Sachaufklärung tatsächlich erschwert oder den Prozess verzögert.
Das war hier gerade nicht der Fall. Der Rechtsstreit war nach Auffassung des Landgerichts selbst entscheidungsreif; die streitigen Fragen, zu denen das Gericht Auskunft haben wollte, waren für die Entscheidung nicht erheblich.
Das OLG verweist zutreffend darauf, dass die Ordnungsgeldfestsetzung damit bereits im Ansatz gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstieß. Selbst wenn man das Nichterscheinen der Partei als „Ausbleiben“ wertete, hätte eine Sanktion vorausgesetzt, dass dadurch der Fortgang des Verfahrens beeinträchtigt wurde. Das war nicht ersichtlich.
Im Gegenteil: Das Landgericht hatte den Verfügungsantrag bereits wegen Fehlens eines Verfügungsgrunds abgewiesen – die vermeintlich unklaren Fragen spielten also keine entscheidungstragende Rolle.
Der Beibringungsgrundsatz und seine Aushöhlung in der Praxis
Der Beschluss des OLG Stuttgart lenkt den Blick auf ein tiefer liegendes Problem: Immer häufiger ist in der gerichtlichen Praxis zu beobachten, dass Gerichte den Beibringungsgrundsatz und das Prinzip der Parteiherrschaft aus den Augen verlieren.
Nach der Systematik der Zivilprozessordnung obliegt es den Parteien, die tatsächlichen Grundlagen des Rechtsstreits darzulegen und zu beweisen. Das Gericht entscheidet über den von ihnen „beigebrachten“ Sachverhalt, nicht über eigene Ermittlungen. Die richterliche Aufklärungspflicht (§ 139 ZPO) ist kein Einfallstor für inquisitorische Befragungen, sondern dient ausschließlich der Verfahrensförderung und der Gewährleistung rechtlichen Gehörs.
Wenn Gerichte ihre mündlichen Verhandlungen dazu nutzen, vermeintlich „offene Punkte“ selbst aufzuklären oder Parteien gleichsam unter Beweisdruck zu befragen, überschreiten sie die Grenze zur unzulässigen Amtsaufklärung. Noch bedenklicher wird es, wenn sie anwaltlich vertretene Parteien sanktionieren, weil deren Anwälte bestimmte Detailfragen – aus Sicht des Gerichts – nicht „zu ihrer Zufriedenheit“ beantworten konnten.
Damit wird der Zweck des § 141 ZPO verfehlt. Die Vorschrift soll der gerichtlichen Verständigung und gütlichen Beilegung dienen, nicht der faktischen Sanktionierung unwillkommener Prozessführung.
Die richterliche Rolle: Neutralität statt Interventionismus
Die Entscheidung aus Stuttgart zeigt exemplarisch, wie wichtig es ist, die Rollenverteilung im Zivilprozess zu respektieren. Der Richter ist Organ der Rechtspflege – nicht Verfahrensbeteiligter. Seine Aufgabe besteht darin, über den Parteivortrag zu entscheiden, nicht diesen zu erzwingen oder nach eigenem Ermessen zu ergänzen.
Das Gerechtigkeitsstreben, das viele Richter mit großem Engagement antreibt, darf nicht mit inhaltlicher Parteilichkeit oder Ermittlungsneigung verwechselt werden. Der Zivilprozess ist kein Forum, in dem die „materielle Wahrheit“ um jeden Preis ermittelt werden soll. Er ist ein formalisiertes Verfahren zur rechtlichen Beurteilung des von den Parteien dargelegten Sachverhalts.
Wer diese Struktur aufweicht, schwächt das Vertrauen in die Neutralität der Justiz – und untergräbt letztlich die Akzeptanz gerichtlicher Entscheidungen selbst.
Fazit
Das OLG Stuttgart hat eine klare Grenze gezogen: Ordnungsgelder sind kein Instrument richterlicher Frustrationstoleranz. Sie dürfen nicht dazu dienen, die Prozessführung einer Partei oder den Kenntnisstand eines Anwalts zu sanktionieren.
Die Entscheidung erinnert daran, dass auch im einstweiligen Rechtsschutz die Zivilprozessordnung gilt – und mit ihr der Beibringungsgrundsatz als tragendes Prinzip des Parteiprozesses. Richterliche Autorität erwächst nicht aus der Durchsetzung subjektiver Überzeugungen, sondern aus der Bindung an das Gesetz. Und das Gesetz verlangt im Zivilprozess nicht Wahrheitsermittlung, sondern Rechtsprechung.
Mein persönliches Motto mag banal und langweilig klingen, ist aber mE Grundlage für jede rechtsstaatliche Entscheidung. Der vorliegende Fall bietet Anlass, dies auch hier zu wiederholen:
Der Wert des Rechtsstaats beruht nicht darauf, dass richterliche Urteile jederzeit von jedermann nachvollzogen werden können, sondern darauf, dass sie aufgrund von Verfahrensregeln gefällt werden, die von vornherein feststehen und von allen Beteiligten eingehalten werden.