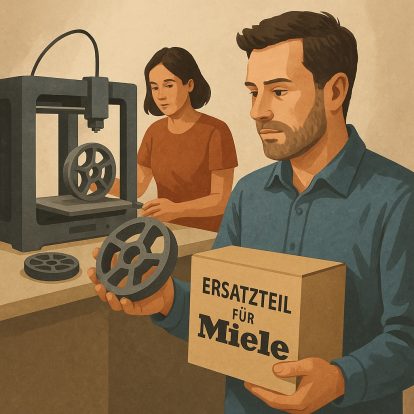
Ein Händler für Ersatzteile hatte in seinem Onlineshop einen Nachfüll-Deckel für Miele PowerDisk angeboten. Was als nützlicher Service für Verbraucher gedacht war, wurde schnell zum Ausgangspunkt einer wettbewerbsrechtlichen Auseinandersetzung:
Eine Mitbewerberin mahnte den Händler ab – mit dem Vorwurf, die Produktdarstellung sei geeignet, den Eindruck zu erwecken, es handele sich um ein Originalteil von Miele.
Die Irreführung beginnt oft schon bei Google
Der Vorwurf drehte sich nicht um den Inhalt der Produktseite selbst, sondern um das, was Google daraus machte. Denn die Suchmaschine übernahm den vom Händler gesetzten „Title Tag“ – also die Überschrift, die im Browser-Tab und im Suchergebnis erscheint:
„Ersatzteil für Miele – XZY“
Nach Auffassung der Abmahnerin sei das problematisch, weil dieser Titel suggeriere, der Artikel stamme von Miele selbst oder sei jedenfalls mit Zustimmung des Unternehmens hergestellt. Der Zusatz „für“ genüge ohne weitere erläuternde Zusätze wie „passend für“ oder „kompatibel mit“ nicht, um den Eindruck einer Originalware auszuschließen.
Tatsächlich – und darin lag die Brisanz – stammte die irreführende Darstellung nicht von Google selbst, sondern von den technischen Angaben des Händlers: Der Inhalt von <title> und <meta property="og:title"> bestimmte, wie das Angebot in der Suchmaschine erschien.
Rechtliche Bewertung: Zwischen Herkunftstäuschung und Verbraucherrealität
Juristisch geht es um § 5 Abs. 2 Nr. 1 UWG – die Irreführung über die betriebliche Herkunft einer Ware. Ein Händler darf also keine Bezeichnung verwenden, die den Verbraucher darüber täuscht, von wem ein Produkt tatsächlich stammt. Doch was heißt „täuschen“ in einem Markt, in dem 3D-Druck, Nachbauten und „passende Ersatzteile“ längst Alltag sind?
In der Rechtsprechung zeichnet sich inzwischen ein differenzierteres Bild: Wird ein Produkt eindeutig als Ersatzteil eines Drittanbieters beworben, etwa durch die Verwendung von Begriffen wie „passend für“, “kompatibel zu” oder durch den Hinweis auf den 3D-Druck, wird ein durchschnittlicher Verbraucher nicht automatisch annehmen, es handele sich um ein Originalteil des Herstellers.
Gerade im Bereich der additiven Fertigung weiß der Verbraucher, dass es sich häufig um Reproduktionen handelt, die mit Originalteilen lediglich funktional kompatibel sind. Das Oberlandesgericht Hamm hat deshalb in einem vergleichbaren Fall ausdrücklich betont, dass der verständige Verbraucher beim Angebot von 3D-gedruckten Ersatzteilen nicht ohne Weiteres von einem Originalteil ausgeht – insbesondere dann nicht, wenn aus der Gesamtgestaltung hervorgeht, dass es sich um ein 3D-Druck-Produkt eines anderen Anbieters handelt (OLG Hamm Beschl. v. 30.9.2024, Az. 4 W 33/24).
Anders liegt der Fall allerdings, wenn der Titel, die Produktdarstellung oder gar das Produktfoto den Eindruck einer offiziellen Herkunft erwecken. Eine Irreführung kann schon dann vorliegen, wenn der Verbraucher durch eine missverständliche Überschrift oder ein unklar formuliertes Snippet überhaupt erst dazu veranlasst wird, das Angebot anzuklicken. Das unlautere „Anlocken“ beginnt also häufig schon in der Suchergebnisliste.
Miele als Prüfstein für die Praxis
Der konkrete Fall zeigt exemplarisch, wie sensibel das Thema ist, wenn bekannte Marken wie Miele im Spiel sind. Händler, die Ersatz- oder Nachfüllprodukte für Markenartikel anbieten, dürfen diese Marken zur Bestimmungsangabe verwenden – also, um dem Verbraucher zu erklären, wofür das Produkt gedacht ist. Doch die Grenze ist dort erreicht, wo die Marke nicht mehr nur beschreibend, sondern herkunftshinweisend eingesetzt wird.
Ein „Nachfüll-Deckel für Miele“ kann also durchaus eine zulässige Formulierung sein – wenn der Gesamteindruck des Angebots klarstellt, dass das Produkt nicht von Miele stammt, sondern lediglich für deren Geräte geeignet ist. Das muss nicht zwangsläufig durch den Zusatz „kein Originalteil“ geschehen. Entscheidend ist vielmehr die Gesamterscheinung des Angebots:
- Wie ist der Titel formuliert?
- Welche Begriffe erscheinen in den Suchergebnissen?
- Welche Bilder werden gezeigt?
- Ist der Anbieter klar als Drittanbieter erkennbar?
Erst das Zusammenspiel dieser Elemente entscheidet darüber, ob eine Irreführung vorliegt oder nicht.
Was Händler daraus lernen können
Für Onlinehändler, insbesondere im Bereich des 3D-Drucks, bedeutet das: Die rechtliche Zulässigkeit hängt nicht von einzelnen Worten ab, sondern vom Gesamteindruck des Angebots. Eine klare und konsistente Kommunikation über alle Kanäle hinweg – also im Shop, auf Plattformen und in den Suchmaschinen-Snippets – ist der beste Schutz vor Abmahnungen.
Wer seine Produkte in den Metadaten präzise beschreibt und zugleich durch Anbietername, Bildgestaltung und Produktbeschreibung eine eigenständige Identität zeigt, wird regelmäßig auf der sicheren Seite sein.
Abmahnungen entstehen meist dort, wo unbedacht kopierte Titel, automatisierte Feed-Texte oder unvollständige SEO-Vorgaben den Eindruck eines „Originalprodukts“ erzeugen. Händler sollten deshalb ihre SEO-Templates, Open-Graph-Angaben und Produktdatenfeeds regelmäßig überprüfen – nicht nur auf Keywords, sondern auch auf lauterkeitsrechtliche Risiken.
Was Abmahner daraus lernen können
Abmahner sollten stets bedenken, dass jeder Fall einer individuellen rechtlichen Bewertung bedarf. Es kommt auf die konkreten Umstände des Einzelfalls an. Es genügt daher nicht, in einer Abmahnung wahllos oder lieblos Gerichtsentscheidungen zu zitieren, die sich lediglich mit ähnlichen, aber eben nicht identischen Sachverhalten befasst haben. Eine solche Vorgehensweise wirkt nicht nur unprofessionell, sondern kann auch die Überzeugungskraft der Abmahnung infrage stellen und Gegenansprüche auslösen.
Darüber hinaus müssen sich vermeintliche Gläubiger immer auch mit der Frage der Aktivlegitimation auseinandersetzen – insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtslage im Wettbewerbsrecht.
Gerade im Bereich des 3D-Drucks zeigt sich dies deutlich: Anbieter von 3D-Drucken stehen zwar theoretisch in Konkurrenz zu einer Vielzahl von Ersatzteilanbietern im Internet. Ob sie ihre Produkte jedoch tatsächlich in einem bestimmten Ersatzteilsegment in nennenswertem Umfang und nicht nur gelegentlich anbieten, ist eine ganz andere Frage – und kann über die Aktivlegitimation entscheidend sein.
Fazit
Die juristische Linie wird klarer: Nicht jeder Hinweis „für Miele“ ist irreführend. Entscheidend ist, wie der Verbraucher die Angabe im Kontext versteht. Wer transparent macht, dass er ein funktional passendes 3D-Druck-Ersatzteil anbietet, bewegt sich in einem rechtssicheren Rahmen.
Aber: Schon kleine Ungenauigkeiten in den Metadaten können eine große Wirkung entfalten – und zu kostspieligen Abmahnungen führen.
Der Fall zeigt: Wettbewerbsrecht im E-Commerce spielt sich längst nicht mehr nur auf der Produktseite ab, sondern auch im unsichtbaren Quelltext.
